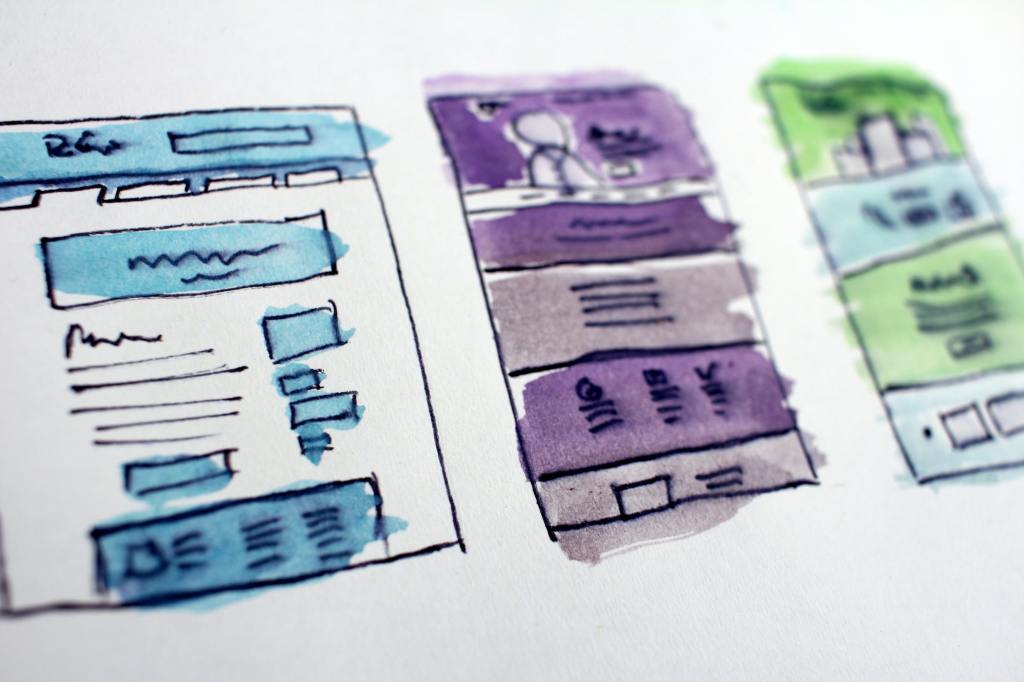„Ein Barcamp ist mal eine nette Abwechslung zu anderen Formaten. Aufgrund der 45-minütigen Sessions bietet es aber weder Vertiefung noch echte Qualität, letztlich bleibt es bei einer gut gemeinten „Schön, dass wir mal darüber gesprochen haben“-Veranstaltung.“ Diese Vorstellung und auch entsprechende Erfahrungen und Missverständnisse häufen sich. Sie hängen damit zusammen, dass in den letzten Jahren zunehmend Veranstaltungen als Barcamp bezeichnet wurden, die keine sind. Der Begriff dient einerseits als Etikett, mit dem Veranstaltungen verkauft werden, andererseits verstehen Veranstalter:innen zuweilen nicht, was ein Barcamp wirklich ist.
Barcamps werden ähnlich missverstanden wie digitale Endgeräte: Sie werden als Add-on gesehen, als ein neues Werkzeug bzw. eine weitere Methode. Das Transformative bleibt verborgen,es wird nicht erkannt, dass es eine andere, gewandelte Kultur entsteht. Barcamps sind eine Antwort auf eine immer komplexere Welt. Wer ein Tablet oder Smartphone nur dafür nutzt, um alte Arbeitsblätter zu digitalisieren, und sie nicht als Kulturzugangsgeräte versteht (wie sie Lisa Rosa vor Jahren treffend bezeichnet hat), wird auch ein altes Veranstaltungskonzept, das aus Workshops besteht, als Barcamp verkleiden und bewerben, ohne jemals die Idee verstanden und das Potenzial ausgeschöpft zu haben.
Wann ist also ein Barcamp ein echtes, ein gutes Barcamp, an welcher Stelle ergibt es einen Sinn und was kann es tatsächlich leisten?
Wann ist ein Barcamp ein Barcamp?
Wer Barcamp googelt, wird neben dem Wikipedia-Eintrag unzählige Beiträge finden, die meist nur beschreiben, was ein Barcamp ist, indem sie den Rahmen und die Regeln vorstellen. Hinter ihnen steckt aber eine Idee. Sie erfüllen einen Zweck und können mit dem richtigen Verständnis eine Flamme entzünden. Den Rahmen und die Regeln nur zu reproduzieren, reicht dafür allein nicht aus. Aus einem anfänglichen Format, das den Gegensatz zu klassischen Konferenzen abbilden sollte, haben sich über die Jahre ganze Communities und eine Kultur, wie miteinander gearbeitet und gelernt wird, entwickelt. Diese Barcamps verfolgen und bewirken eine Kultur (der Digitalität), die maximal selbstbestimmt, partizipativ, agil, gleichberechtigt, offen, transparent, kollaborativ und inklusiv ist.
Barcamps sind divers, hinsichtlich der Teilnehmenden, der Themen und der Veranstaltungsorte. Dennoch hat sich ein organisatorischer Rahmen etabliert und es gibt verbindliche Regeln. Sie bilden einen Konsens und eine Orientierung, die ich wie folgt zusammenfassen würde:
Der Rahmen
Ein Barcamp besteht aus mehreren Zeitschienen (sog. Slots), die jeweils 45 Minuten dauern, in denen verschiedene Sessions zeitgleich in unterschiedlichen Räumen stattfinden und auf die jeweils 15 Minuten Pause folgen. Die Sessions können als Impulsvortrag mit Diskussion, Workshop oder Diskussionsrunde zu einer Frage stattfinden. Das Programm, also welche Sessions von wem, wann und wo angeboten werden, wird erst vor Ort, am Tag des Barcamps, mit allen Anwesenden gemeinsam ausgehandelt. Es gibt dafür eine Moderation, die zu Beginn alle Barcamp-Regeln erklärt und danach Personen ihre Session-Vorschläge kurz vorstellen lässt. Wenn Anwesende Interesse an der Session haben, heben sie ihre Hand. Dann erhält eine Session einen festen Zeitpunkt und Ort im Programm. Davor gibt es meist eine schnelle Vorstellungsrunde.. Bei ganztägigen Barcamps gibt es eine Mittagspause. In der Regel wird den Tag über ein Buffet bzw. werden Essen und Trinken (kostenfrei) angeboten. Am Ende des Barcamps gibt es einen gemeinsamen Abschluss,oft in Form von einzelnen Rückmeldungen zum Tag.
Die Regeln
- Auf einem Barcamp wird geduzt.
- Es gibt einen Hashtag, mit dem im Netz über das Barcamp gesprochen werden soll.
- Pro Slot werden in der Regel maximal so viele Sessions geplant, wie Räume vorhanden sind.
- Eine Session findet dann statt, wenn sich außer der anbietenden Person mindestens eine weitere dafür interessiert.
- Bei den Sessions steht der Austausch im Mittelpunkt, alle Teilnehmer:innen gestalten sie mit. Deshalb spricht man von Teilgerber:innen.
- Das Wesentliche einer Session wird protokolliert und das Protokoll veröffentlicht.
- Sessiongeber:innen suchen zu Beginn ihrer Session nach einer oder mehreren Personen, die protokollieren.
- Das Gesetz der zwei Beine besagt, dass Teilgeber:innen jederzeit eine Session verlassen, zu einer anderen wechseln oder die Zeit anders nutzen können.
Kultur der Digitalität und Kontrollverlust
Da die Idee der Barcamps aus der Tech-Szene stammt, wurden sie von Beginn an in einer Kultur der Digitalität gedacht. Deshalb werden Protokolle häufig mit Etherpads von mehreren Personen kollaborativ, gemeinsam erstellt und Ideen, Fragen und Antworten aus den Sessions oder sogar gesamte Protokolle (über Etherpad-Links) mit dem Hashtag des Barcamps im Netz veröffentlicht. Sie bilden damit alle Merkmale einer Kultur der Digitalität ab: Referentialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Dadurch, dass Informationen, Wissen und Anregungen während der Barcamps (meist über Twitter) im Netz geteilt, zugänglich gemacht und teilweise sogar Beteiligungen an Sessions ermöglicht werden, sind sie übrigens schon von Beginn an hybride Veranstaltungen gewesen und haben den transformierten Raum verstanden und berücksichtigt.
Um ein „echtes“, gutes Barcamp zu erhalten, braucht es deshalb ein Commitment möglichst vieler und bestenfalls aller Beteiligten zur beschriebenen Kultur. Wo diese vorher schon vertreten und gelebt wird, können Barcamps ihr volles Potential entfalten. In Bereichen, in denen eher hierarchische Strukturen und intransparente Prozesse herrschen und normalerweise wenig bis keine Partizipation stattfindet, werden es (echte) Barcamps sehr schwer haben, weil sie einen Kontrollverlust bedeuten und entgegengesetzt zur vorherrschenden Lern- und Arbeitskultur stehen. So werden dort Veranstaltungen durchgeführt und auch als Barcamp bezeichnet, bei denen beispielsweise auf das Duzen verzichtet wird, das Programm schon Wochen im Voraus steht und Sessions aus 45-minütigen Vorträgen bestehen. Somit handelt es sich dabei um Schein-Barcamps.
Was kann ein Barcamp leisten?
„Ein Barcamp ist das, was ihr daraus macht“ ist häufig der letzte Hinweis, mit dem alle in die erste Session verabschiedet werden. Dadurch werden der individuelle Gestaltungsraum, aber auch die Eigenverantwortung und die diversen Perspektiven deutlich. Wer ein Barcamp wie erlebt, hängt vom eigenen Handeln ab. Deshalb kann eine schlechte Erfahrung bei einem Barcamp entweder ein Indikator dafür sein, dass der Rahmen und die Regeln nicht eingehalten wurden, oder dass die notwendige Kultur nicht ausreichend gelebt wurde. Wer aus falsch verstandener Höflichkeit in Sessions sitzen bleibt, die ihn nicht interessieren, die Möglichkeit nicht nutzt, sich mit einer eigenen Session einzubringen oder sich in Sessions nicht beteiligt, kann eine negative Erfahrung machen, die teilweise selbstverschuldet* ist und nicht allein dem Barcamp zugeschrieben werden kann. Auch wenn das trotzdem häufig getan wird.
(*Weil es nicht ausreicht, nur einen Raum für Beteiligung bereitzustellen, sondern Beteiligung ebenfalls gelernt werden muss, kann so eine Erfahrung auch nur teilweise selbstverschuldet sein.)
Wer verstanden hat, dass und welche Kultur hinter Barcamps steckt, wird sie nicht als einzelnes Ereignis planen und einsetzen, sondern mit ihnen die bereits beschriebene Lern- und Arbeitskultur einführen, etablieren oder fortführen. Operativ bieten sie sich an, um Prozesse (in einem System) zu beginnen oder laufende zu reflektieren und daran weiterzuarbeiten. Sie bieten einen Raum für Dinge, die sonst keinen erhalten. Mit ihnen können Bedürfnisse und Bedarfe ermittelt werden. Barcamps können erfahrungsgemäß Kräfte freisetzen, Personen, die sich lange Zeit nicht beteiligt haben, reaktivieren und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Sie können für Gruppierungen und Themen, die sonst wenig miteinander zu tun haben, einen Begegnungsraum bieten. In einer Welt, in der die Komplexität der Herausforderungen stetig zunimmt, können Barcamps das leisten, was gesellschaftlich notwendig ist: Probleme interdisziplinär und multiperspektivisch zu erfassen und zu lösen.
Schulen und Barcamps
Mit regelmäßigen Barcamps kann eine zeitgemäße Lern- und Arbeitskultur in Schulen erreicht werden. Sie eignen sich als pädagogische Tage des Kollegiums, als Elemente einer wirksamen und nachhaltigen Schulentwicklung, als Schultage mit allen an Schule Beteiligten, die auch für Externe geöffnet werden können oder als Lern- und Arbeitsform im Unterricht einer Klasse oder Stufe sein. Mein konkreter Vorschlag wäre, ein Schuljahr mit einem monatlichen Schultag als Barcamp zu beginnen und perspektivisch auf einen wöchentlichen hinzuarbeiten. Einen Teil der Konferenzen würde ich durch Barcamps ersetzen, wie auch pädagogische Tage und würde sie auch vermehrt nutzen, um sich mit externen Expert:innen und anderen Schulen aus der Umgebung (und darüber hinaus) stärker auszutauschen und zu vernetzen.
(Mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung werden in Baden-Württemberg ab nächstem Schuljahr auch im Fortbildungsbereich Barcamps eine deutlich stärkere Rolle spielen.)
Bitte und Einladung
Nach diesem Beitrag müsste nun klar sein, dass es wesentlich vom Verständnis und Handeln der Organisationsteams, aber auch der restlichen Anwesenden abhängt, wie viel Barcamp in einem Barcamp steckt und was es tatsächlich leisten kann. Als jemand, der seit vielen Jahren nicht wenig Zeit und Kraft investiert, im Bildungssystem oder im kommunalen Raum eine gewandelte Lern- und Arbeitskultur einzuführen, zu etablieren und fortzuführen, bitte ich darum, Veranstaltungen nicht Barcamp zu nennen, wenn nur einzelne Elemente davon darin vorkommen und es sich aus PR-Gründen anbietet. Dieses Vorgehen reduziert Barcamps nicht nur zu einem Buzzword, sondern verbaut auch zukünftige Chancen und hemmt notwendige Veränderungen. Durch die Erfahrung mit Schein-Barcamps schwinden bei Menschen das Interesse, die Bereitschaft und die Gelegenheiten, echte Barcamps zu besuchen, durchzuführen und eine zeitgemäßen Lern- und Arbeitskultur kennenzulernen.
Wer sich fragen sollte, wo man denn nun so ein echtes Barcamp erleben kann, lade ich herzlich zum Barcamp Lernräume in Freiburg ein. Ansonsten lege ich für die EduCamps oder die Edunautika in Hamburg meine Hand ins Feuer. Es gibt aber unzählige Barcamps, die sehr gut sind und auch nicht mit Bildung zu tun haben. Meldet euch einfach an und sammelt am besten eigene Eindrücke und Erfahrungen. Mit diesem Beitrag habt ihr eine Möglichkeit, euch zu orientieren, falls ihr ein Barcamp besucht oder selbst eines durchführen möchtet. Wer sich vertieft mit der Thematik auseinandersetzen möchte, findet hier im OER-Buch Barcamps & Co. von Jöran Muuß-Merholz zahlreiche Tipps, Hinweise und Checklisten. Möge die Barcamp-Flamme in euch entzündet werden.
(Wer eine konkrete Unterstützung oder Beratung wünscht, kann sich an ein erfahrenes Team von freiburg_gestalten wenden. Wir haben dort schon in vielen Kooperationen mit Städten, Hochschulen oder Vereinen diverse Barcamps durchgeführt.)